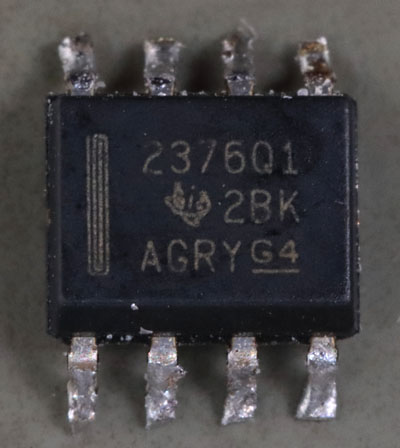
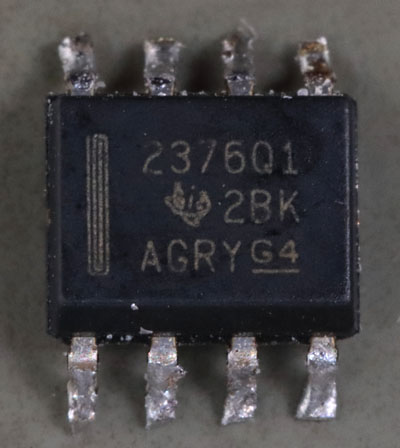
Der Texas Instruments OPA2376 enthält zwei Präzisions-Operationsverstärker. Die Bezeichnung der Grundvariante mit einem Operationsverstärker lautet OPA376. Daneben hat Texas Instruments den OPA4376 mit vier Operationsverstärkern im Programm. 2,2V reichen aus, um den Baustein zu betreiben. Die Ruhestromaufnahme beträgt typischerweise 760µA. Sowohl die Eingänge als auch die Ausgänge sind Rail-to-Rail, arbeiten also in einem Spannungsbereich bis hin zu den Versorgungspotentialen. Die Grenzfrequenz liegt bei 5MHz. Die Slewrate wird mit 2V/µs angegeben.
Der OPA2376 besitzt eine CMOS-Eingangsstufe und bietet trotzdem eine geringe Offsetspannung von typischerweise 5µV, maximal 25µV. Dies realisiert Texas Instruments mit einer Technik, die als "e-trim" bezeichnet wird. Niedrige Offset-Spannungen erreicht man mit spezieller Schaltungstechnik oder mit einem Abgleich der Schaltung. Im Bereich der Schaltungstechnik gibt es zum Beispiel Chopper-Opamps oder Auto-Zero-Opamps wie den LTC1051. Eine sehr weit verbreitete Art des Abgleichs ist der Einsatz von Fuses. Dabei sind in den Eingangsstufen Widerstände parallel geschaltet, die in Teilen abgetrennt oder zugeschaltet werden können. Dafür verwendet man Fuses oder Antifuses. Fuses bestehen aus dünnen Elementen der Metalllage oder der Polysiliziumlage, die durchgebrannt werden. Antifuses sind typischerweise Diodenstrecken, die mit einem Stromimpuls zerstört und damit dauerhaft leitend geschaltet werden können. Der OP400 ist ein Beispiel dafür. Will man die Offsetspannung noch genauer abgleichen, so kann man spezielle Widerstandsflächen integrieren, die dann mit einem Laser passend zugeschnitten werden.
Der Abgleich der Offsetspannung hat einen relevanten Einfluss auf die Herstellungskosten eines Operationsverstärkers. Wenn der Abgleich stattfindet bevor der Operationsverstärker mit seinem Gehäusematerial umspritzt wird, können die dabei auftretenden thermischen und mechanischen Belastung die Offsetspannung wieder erhöhen. Mit der e-trim Technologie hat Texas Instruments beide Punkte optimiert.

Die e-trim Technik erlaubt es Texas Instruments die Offsetspannung des OPA2376 nach der Integration in das Gehäuse verhältnismäßig einfach abzugleichen. Das obige Blockschaltbild zeigt was sich dahinter verbirgt. Es stammt aus der Application Note "Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim™, and Chopper". Es werden weiterhin Widerstände in der Eingangsstufe abgeglichen. Dies erfolgt allerdings nicht mehr direkt, sondern über eine Schaltung, die hier als "Trim Control" bezeichnet ist. Während der Produktion wird der initiale Wert der Offsetspannung gemessen und die notwendige Korrektur bestimmt. Diese Korrektur überträgt man digital durch den Ausgang des Operationsverstärkers zur Trim Control Schaltung. Am Ende der Prozedur wird die Funktion gesperrt.

Das Datenblatt des OPA2376 enthält ein deutlich einfacheres Blockschaltbild. Demnach könnte es auch sein, dass der Abgleich nicht direkt am Eingang erfolgt. Das erscheint aber eher unwahrscheinlich. Eine nicht abgeglichene Eingangsstufe würde sich trotz des späteren Abgleichs negativ auf das Gesamtverhalten der Verstärkerstufe auswirken. POR steht normalerweise für Power-On-Reset. Das würde bedeuten, dass der Baustein einen gewissen Aufstartvorgang durchläuft.
Im Vergleich zu den älteren Abgleich-Methoden ist die e-trim Funktion deutlich komplexer. In Bausteinen wie dem OP400 werden die Widerstände in der Eingangsstufe während der Produktion angepasst. Danach ist die Schaltung fixiert und ändert sich nicht mehr. Im Fall des OPA2376 muss beim Aufstarten eine Logik die abgespeicherten Korrekturwerte auslesen und damit die Kompensationsschaltung in der Eingangsstufe konfigurieren.
Die Abmessungen des Dies betragen 2,1mm x 1,0mm. Die beiden Operationsverstärker sind punktsymmetrisch angeordnet. Die Eingangsstufen befinden sich im Zentrum des Dies, die Ausgangsendstufen sind links und rechts relativ weit außen, dort aber mittig platziert. Diese Anordnung sorgt dafür, dass die Eingangstransistoren mit möglichst wenig Temperaturgradienten belastet werden. Temperaturgradienten würden zu Offsetdrifts führen. Eine vollständige Analyse der Schaltung gestaltet sich nicht nur wegen der kleinen Strukturbreiten schwierig. Der OPA2376 nutzt mehrere Metalllagen und die Zwischenräume sind mit Dummystrukturen aufgefüllt.
Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar: 27MB
Außerdem ist ein Bild des rechten Operationsverstärkers in einer noch höheren Auflösung verfügbar: 94MB
Trägt man die Metall- und Polysiliziumlagen ab, so geht die Information der Verdrahtung und teilweise auch der Aufbau der aktiven Elemente verloren. Einige Funktionsblöcke lassen sich aber deutlich einfacher zuordnen. Im Überblick zeigt sich, dass überraschend große Flächen keine aktiven Elemente enthalten. Einen Teil dieser Flächen nehmen Kondensatoren ein. Es finden sich aber auch einige vollständig freien Flächen. In diesen Bereichen verlaufen breite Leitungen, die hohe Ströme übertragen. Offenbar besteht eine nicht unerhebliche Gefahr, dass diese Leitungen aktive Elemente darunter beeinflussen.
Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar: 29MB

5080 scheint die interne Projektbezeichnung zu sein. Darunter sind einige Teststrukturen abgebildet. Es scheinen drei Metalllagen zum Einsatz gekommen zu sein.

Die Anordnung der Bondpads ist aus elektrischer Sicht nicht ideal. Der Ausgang und der Eingang +IN der linken Schaltung liegen nahe bei ihren jeweiligen Schaltungsteilen. Der Eingang -IN wurde aber überraschend weit links platziert. Die Platzierung der Bondpads des rechten Operationsverstärkers erscheinen elektrisch deutlich weniger sinnvoll. Das Ausgangspotential wird eine weite Strecke von der rechten Kante bis in die Mitte des Dies übertragen. Der Eingang +IN muss einen ähnlich langen Weg in die entgegengesetzte Richtung überbrücken. Die Anordnung der Bondpads ergibt sich oft durch das übliche Pinning im Package.

Auch wenn sich die Schaltung nicht im Detail analysieren lässt, so kann man einige Funktionsblöcke doch identifizieren. Die Eingangstransistoren (rot) fallen durch ihren großen Flächenbedarf auf. Eine große Transistorfläche sorgt bei der richtigen Verschaltung für einen geringen Temperaturdrift der Offsetspannung. Außerdem reduziert die große Fläche das Rauschen der Eingangsstufe. Die Ausgangsstufe (blau) findet sich, wenn man die breiten Leitungen des Ausgangsbondpads nachverfolgt.
Sehr prominent sind die zehn Fuses an der rechten Kante des Dies (gelb). Daneben befindet sich die zugehörige Logik (grün). Von den Fuses führen neun Leitungen zu dem Bereich, der offenbar den Offsetfehler ausgleicht (lila). Die Platzierung erscheint logisch. Die Konfiguration der Fuses erfolgt über ein digitales Signal, das am Ende der Produktion in den Ausgang eingespeist wird. Die Logik muss dieses Signal auswerten und die richtigen Fuses auslösen.
In der Nähe der Ausgangsstufe finden sich zwei weitere sehr kleine Logikbereiche (orange). Vielleicht handelt es sich um Hilfsschaltungen für die e-trim Logik.

Die Fuses selbst sind von massiven Leitungen umgeben. Unter den Fuses befinden sich verhältnismäßig große Transistoren. Diese müssen ausreichend Strom leiten können, um die Fuses sicher unterbrechen zu können. Unter den Fuses sind immer die gleichen Schaltungen integriert. Anscheinend übernimmt dieser Schaltungsteil die Ansteuerung der Leistungstransistoren und überträgt später den Status über insgesamt neun Leitungen, die nach unten weggeführt werden.
Die Fuses sind über jeweils eine Leitung mit dem Logikbereich verbunden. Der Logikbereich selbst ist hier nur schlecht zu identifizieren.

Auf Substratebene lässt sich der Logikbereich deutlicher identifizieren. Dort zeigen sich die typischen in Zeilen angeordneten etwas chaotischen Blöcke der verschiedenen Gatter.
Im Bereich der Fuses werden nun auch die großen Leistungstransistoren sichtbar. Darunter befinden sich die etwas vergrößerten Treibertransistoren und darunter wiederum Logikgatter.

Der Durchmesser der Fuses beträgt an der dünnsten Stelle nur 0,4µm. Der Unterschied zwischen einer intakten und einer ausgelösten Fuse ist deutlich zu erkennen.

Es handelt sich um zehn Fuses, von denen drei ausgelöst wurden (rot). Aus dem Logikbereich führt eine Leitung zu jeder Fuse (grün). Eine Fuse ist über eine zweite Leitung mit dem Logikbereich verbunden (türkis). Aus dem Fuse-Bereich führen neun Leitungen zur Eingangsstufe. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Fuse mit der zusätzlichen Leitung eine Verriegelung darstellt. Sie wird nach der Konfiguration ausgelöst und sperrt die Logik.

Die neun Leitungen aus dem Fuse-Bereich sind mit einem rechteckigen Block unterhalb der Eingangsstufe verbunden. Dort scheint eine Matrix mit sehr vielen Transistoren und Widerständen integriert zu sein. Aus der Leitungsführung kann man erahnen, dass diese Transistoren und Widerstände in größere und kleinere Gruppen zusammengeschaltet wurden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um unterschiedlich große Kompensationsschritte. So kann man mit wenigen Fuses einen großen Bereich mit einer verhältnismäßig kleinen Auflösung einstellen. Über die exakte Funktionsweise der Offset-Kompensation kann man nur spekulieren. Sicher ist lediglich, dass die konfigurierbaren Widerstände die Schaltung im Bereich der Eingangsstufe beeinflussen.
Mit diesem Hintergrund ist es fraglich, ob der OPA2376 tatsächlich einen Power-On-Reset durchführt. Technisch sollte es möglich sein, dass der Fuse-Bereich nach dem Hochfahren der Versorgungsspannung ohne Zeitverzögerung seine Konfiguration über die diskreten Steuerleitungen zum Trim-Bereich schickt. Der Operationsverstärker kann dann verzögerungsfrei seinen Betrieb mit der spezifizierten Offsetspannung aufnehmen. Die Abkürzung POR könnte im Zusammenhang mit dem OPA2376 für etwas anderes stehen, zum Beispiel "Production Offset Reading".
